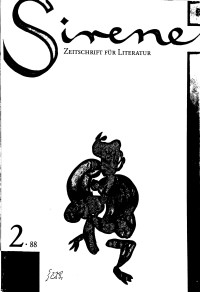Michael Basse
Der lange Weg des Johannes Poethen
In:
Sirene
Zeitschrift für Literatur
Band 2
München 1988
I.
Johannes Poethen ist ein Autor, dessen Werk gemeinhin als schwierig gilt. Häufige Etiketten für sein Werk lauten: Dichtung aus dem Elfenbeinturm, metaphysisch-religiöse Dichtung, Mythendichtung, Hermetismus, hoher lyrischer Sprachton - aber mit Bezug zum Aktuell-politischen etc.. Wie in ähnlichen solchen Fällen (z.B. Wolfgang Bächler) deuten die widersprüchlichen Etiketten der Kritik - je nachdem, woher der Wind weht - nur auf eines hin: daß sie beliebig sind. In einem Nachwort zu dem 1973 bei Claassen erschienen Band Gedichte 1946-1971 stellte der Literaturkritiker Jürgen P. Wallmann fest: "Seit dem Beginn der fünfziger Jahre hat Poethen beharrlich und im Widerstand gegen alle Irritationen von innen und außen an seiner Dichtung gearbeitet, mit einem Ernst und einer Strenge, die heute kaum mehr selbstverständlich sind. Dabei begleiten seine Lyrik kontinuierlich poetologische Essays, in denen Poethen sich selbst Rechenschaft ablegt (...) Denn sowenig er ein epigonaler Klassizist und Anhänger literarischer Konvention ist, so wenig verleugnet er auch das, was er der Tradition von Hölderlin bis zum Surrealismus und Expressionismus verdankt (...) Poethens Dichtungen entsprechen nicht den wechselnden literarischen Tagesmoden und sind deswegen auch 'unwegsam dem Zeitverstand' (...)"
Unwegsam dem Zeitverstand - eine prägnante Formulierung (nach einem Wort von Karl Kraus über die Poesie der Else Lasker-Schüler). Denn trotz aller sogenannten progressiven literaturtheoretischen Forderungen, wie ein Gedicht der Gegenwart auszusehen habe, behauptet sich die Lyrik in ihren besten Vertretern auch heute als eine literarische Gattung, die ihre besondere Aussagekraft aus den gesamten historisch gewordenen Sprachfundus und seiner Identifikation mit dem historisch gewachsenen Seinsvorstellungen bezieht. Eine Lyrik, die im zeitlosen Sinn des Wortes Dichtung ist, ordnet sich eben nicht dem Zeitgeist unter, sondern paßt ihrerseits diesen in das komplexere Bild der Welt ein; sie läßt ihn nicht außer acht, aber sie geht über ihn hinaus und hinter ihn zurück. Sie bildet, nach einem Wort Walter Neumanns, "das Abbild der Zeit, in dem sie es in überzeitliche Relationen setzt, die es prägnanter, genauer, freilich nicht leichter durchschaubarer machen." ("Mythos und Landschaft", in: die horen Heft 92, Hannover 1973). Insofern ist Poethens Dichtung tatsächlich 'unwegsam dem Zeitverstand'. Um so jäher rückt sie etwas anderes ins Blickfeld: daß komplizierte lyrische Sprachbewegungen von wenigen Ausnahmen abgesehen - wie Ingeborg Bachmann oder Paul Celan (der mit Poethen lange Jahre im Kontakt stand) - in deutschen Landen nie Hochkonjunktur hatte. Auch nach dem Krieg wurden Anknüpfungsversuche an die Struktur moderner Lyrik, vor allem der französischen, immer wieder verdrängt durch konkretistische, dokumentarische und politisch-agitatorische Texte; oder sie wurden gänzlich erstickt durch jene massenhafte, einem blinden Authismus folgende Bekenntnislyrik der 'Neuen Innerlichkeit', die sich ihrer restaurativen Regression aufs romantische Erlebnisgedicht nicht einmal mehr bewußt ist. Das schürft und funkt unmittelbar, deshalb ist es auch marktgerecht verwertbar.
Dagegen gilt für Poethens Dichtung wie für die 'Struktur der modernen Lyrik' (Hugo Friedrich) überhaupt: Jede eindeutige Interpretation, jeder Kommentar verfehlt sie zu einem Teil. Diese Lyrik ist präzise und vielschichtig zugleich. Sie erfordert äußerste Konzentration vom Leser. Man kann sich solche Dichtung nur mehr aneignen, wenn man ihre poetologischen Voraussetzungen kennt.
II.
In seinem ersten 1954 in den Akzenten erschienenen poetologischen Essay gebrauchte Poethen für die Dichterwerkstatt den ebenso häufig zitierten wie mißverstandenen Ausdruck "Labor der Träume". Der Ausdruck "Labor" verweist auf das symbolistische Erbe (Verlaine definierte den Dichter als 'Ingenieur im Laboratorium der Sprache'); beim Terminus "Träume" assoziiert man unwillkürlich die surrealistische Tradition, jene traumhafte, bewußte Absichten unterlaufende 'écriture automatique'. Laborwerk und Träume, die Spannung zwischen Apollon und der derangierten Psyche gehören für Poethen von Anfang an zusammen. In anderer Terminologie könnte man auch vom Gegensatz zwischen ästhetischem Kalkül und bloßer Inspiration, beziehungsweise zwischen Form und Inhalt sprechen. Aber diese Gegensätze sind Scheingegensätze. Schon in seinem ersten Essay formulierte Poethen: "Die Chance des Gedichts, Zeit zu überdauern, besteht nicht in dem, was man als 'Inhalt' darin finden mag - 'Inhalt', also Stimmungen, Ideologisches, Wissenswertes, also lauter Persönliches: das ist unverbindlich. Erst die 'Form' macht gültig, erst geformt wird der jeweilige 'Inhalt' verbindlich. Die Anführungszeichen neben 'Inhalt' und 'Form' sind gesetzt, weil erst das mißlungene Gedicht in Formales und Inhaltliches auseinanderfällt." Kaum ein deutscher Poet hatte zu diesem Zeitpunkt die Dialektik zwischen Form und Inhalt im Gedicht derartig hellsichtig erfaßt. Entweder frönte die Kritik mit Hugo Friedrich primärer Sprachartistik á la Benn und Krolow, oder sie verfocht in der Nachfolge Brechts mit jungen Autoren wie Enzensberger das Primat des Inhalts, das heißt des aktuellen und konkreten Wahrheitsgehalts des Gedichts, seines Gebrauchswertes, seiner wie auch immer gearteten "Botschaft". Poethens Poesie verweigert sich solchem Zugriff. Wie für Jean Paul (Vorschule für Ästhetik) ist ihm die Poesie "die einzige zweite Welt in der hiesigen". Sie hat ihre eigenen Gesetze und kein anderes Recht gilt hier. Poethen: "Ein Ding im Gedicht ist nicht übersetzbar in die reale, die hiesige Welt - ganz sicher gilt auch die Umkehrung des Satzes: der Verpflichtung des Lesers in die Mitte des Gedichts zu steigen, von hier aus Umschau zu halten und nur hier Maß und Regeln zu suchen für Genuß und Gedicht; dieser Verpflichtung entspricht das Gebot für den Schreibenden: Verlasse nie dein Gebilde, um Ansprachen zu formulieren, Gesinnungen zu plakatieren". Am ehesten läßt sich diese Auffassung von Gedicht im Konzert poetologischer Konzeptionen der 50er Jahre noch mit derjenigen Günter Eichs vergleichen, der in seiner berühmten Rede "Der Schriftsteller vor der Realität" (1956) von der Grundentscheidung des Schriftstellers sprach, die Welt als Sprache zu sehen. "Aus dieser Sprache, die sich rings um uns befindet, zugleich aber nicht vorhanden ist, gilt es zu übersetzen". Dichtung also als Übersetzung ohne Urtext; und je gelungener die Übersetzung, desto höher der Grad an Wirklichkeit, den die Dichtung damit erzielt.
Die angeblichen Widersprüche zwischen Form und Inhalt, zwischen Wirklichkeits- und Sprachbezug lichten sich am ehesten, wenn man sich einmal das Procedere dichterischer Arbeit, in Concreto bei Poethen, vergegenwärtigt: "Der Arbeit des Schreibens geht die Herstellung einer besonders gearteten Stille voraus. Das Wort 'Stille' soll einen Zustand bezeichnen, in dem nichts zu existieren scheint, nichts Erfühltes, Gedachtes oder Sinnenhaftes, nichts außer Gehör und Gesicht, die auf Empfang gestellt sind", heißt es in seinem ersten Essay. Dreißig Jahre später wird Poethen den Ausgangspunkt dichterischer Produktion noch radikaler fassen: "Der Anfang ist weiß. Die weiße Fläche, der weiße Abgrund, das Angstloch". Und: "Ich bin nur in Wörtern, ich habe kein anderes Alibi" (Helikon - oder das Problem der Inspiration, 1987). - Es bedarf also einiger Anstrengung der Nerven, Stille und Gehör rein zu erhalten. So manches drängt sich da auf: das Unbrauchbare, täuschende Geflüster der Wünsche, Stimmungen, des Meinens, Erkennens und Bekennens oder auch des Spieltriebs. All das wird später einmal mitsprechen, aber erst dann, wenn die erste Zeile aufgenommen ist. Ausweis der ersten Zeile jedoch ist ihre "Fähigkeit, aus der Stille Raum zu schaffen. Ihrer Intensität, ihrer Farbe, ihrem Klang gemäß entsteht um Gehör und Gesicht eine Landschaft, ein Sendegebiet. Zahlreiche Sender liefern von allen Seiten Wortketten, Bildfolgen, Klangmaterial. Jetzt tritt zu Gehör und Gesicht das Kontrollorgan. Auf die Wellenlänge der ersten Zeile geeicht, übernimmt das Organ die Aufgabe zu sondieren, auszuwählen und zu bestätigen." Mit anderen Worten: Das intuitiv einströmende Wortmaterial ist zwar zuerst da, doch ist seine Existenz im Gedicht nicht zu trennen vom bewußten ästhetischen Kalkül. Und so lautet das poetische Bekenntnis auf dieser Stufe:
Im labor der träume
wird das lied dieser stunde gehämmert
(...)
im labor der träume
stirbt der tod.
Der zweite Teil dieses Bekenntnisses will nicht mehr und nicht weniger sagen, als daß im dichterischen Prozeß die Zeit aufgehoben und im Gedicht zu reiner Gegenwart verdichtet ist.
Aber zurück zum ästhetischen Kalkül, zum 'Kontrollorgan', von dem die Rede war, und das für Poethen "ein Produkt aus Zeitgenossenschaft und Vorwelt, Erziehung und Herkunft, Erlesenem, Erdachten, Erfühltem, aus Vorurteil und Nachurteil" ist. Um die formalästhetischen Kriterien dieses 'Organs' beim Aufbau des Gedichts anschaulich zu machen, greift Poethen zurück auf das Bild der griechischen Säule, die als Einheit aus vollendeten Teilen scheint: "Man begriff jede Trommel als Ganzes, gestaltete sie zuende vor ihrer Verwendung. Noch als Bruchstück bleibt sie Kunstwerk. Beim Bau des Gedichts werden die Zeilen ähnlich behandelt. Sie möchten in sich geschlossene, rhythmische Stücke sein, abgerundete Details im Gesamttext. Wo sie enden, dort verhält die Bewegung einen Atem lang. Ein lyrisches Gebilde hat seine ihm nur eigenen Interpunktion. Hinter dem Zeilenende entsteht eine Viertelpause - es bedarf nichts des Kommas; der Strophen- oder der Absatzschluß bedeutet: halbe Pause - ein Punkt dort verlängert den ohnehin dort vorhandenen starken Einhalt. Und innerhalb der Zeile sorgt der Rhythmus für die jeweils notwendige Zäsur. So gesehen, genügt eine geringe Auswahl aus dem Vorrat der geläufigen Satzzeichen." - Während also die einzelne Zeile durch ihren rhythmischen Spannungsbogen in sich zusammengehalten wird, bedürfen die Zeilen im Gedicht keines zusätzlichen Bindemittels - ähnlich der Säule, deren Trommeln durch den puren Druck aufeinander haften. Das Enjambement etwa hätte nur dann Reiz und Berechtigung, so Poethen, wenn die anerkannte Geschlossenheit der Zeile, die selbstverständliche Bindungslosigkeit zwischen den Zeilen, kunstvoll durchbrochen wäre.
Die Zeile als kleinste Einheit des Gedichts, ein Zeilenrhythmus, der sich zum Rhythmus des Gesamtgedichts verhält wie eine Wellenbewegung zur Bewegung des Stroms. "Es wäre denkbar ein gutes Gedicht, in dem jede Zeile ihr eigenes metrisches Gefüge zeigt, es wäre denkbar ein ebenso gutes Gedicht, dem ein durchgängiges metrisches Schema zugrunde liegt, obwohl jede Zeile von einem bloß ihr angehörenden Rhythmus getragen ist." Auffällig an dieser Gedichtkonzeption ist ihr ebenso formbewußter, ja klassischer Anspruch, wie ihre deutliche Abneigung jeglicher Form als Stützkorsett. Wenn überhaupt, dann bedient sich diese Poesie der 'Form als Widerstand' (Harald Hartung) an der sich das vorhandene Material bewähren muß. Jede Zeile als vollendeter Baustein des Gedichts betrachtet läßt eben keine Geschwätzigkeit zu, zwingt das Kontrollorgan zur schärfster Reflexion. Die Bewegung, die ein solches Gedicht als Ganzes vollzieht, mag kompliziert erscheinen - der freie Rhythmus läßt vielfältige Zensuren und retardierende Elemente zu, dennoch kommt es nicht zu Brüchen, folgt Zeile auf Zeile einer zwingenden inneren Bewegung. Stockt die Bewegung, der Atem einer Zeile, muß der Absatz beziehungsweiose das Gedicht notwendig verstummen. Als "Atemwende" bezeichnete auch Paul Celan in seiner Büchnerpreisrede jenen furchtbaren Augenblick des Verstummens, wenn es nicht nur dem Büchnerschen Lenz, sondern uns allen Atem und Wort verschlägt. Das ernsthafte Gedicht kommt um diese "Atemwende" gar nicht herum. Es behauptet sich nach Celans Worten "am Rande seiner selbst; es ruft und holt sich, um beste-hen zu können, unausgesetzt aus seinem Schon-nicht-mehr in sein Immer-noch zurück." Ähnlich wie Celan kalkuliert auch Poethen in seiner Lyrikkonzeption die Möglichkeit des Verstummens nach jeder Zeile mit ein.
III.
Vom Intuitiv einströmenden Wortmaterial und von der Fähigkeit der ersten Zeile, "aus Stille Raum zu schaffen", war die Rede. Bleibt die Frage nach der Herkunft des Materials, respektive ihres Welt- und Wirklichkeitsbezuges. Im Verlauf der 50er Jahre boten sich Poethen zwei entgegengesetzte Bereiche an: die mediteran-südliche Landschaft, vor allem Griechenland, mit ihren alten Figuren: Säule, Ölbaum, Augenblick, in dem die Zeit aufgehoben ist; eine "Landschaft inmitten der Sandwüste"; dann die nördliche technisierte Großstadt, lebensfeindlich, stumpf, dreist und sprachlos, eine Landschaft mit neuen Figuren: Straßennetz, Motor, Augenblicke als Einheiten zählbarer Zeit, eine "Landschaft inmitten der Steinwüste". Poethen:
Uns fiel zu
die dörrende stadt
auf der kreisenden kugel
grundlos.
Ihren vernichtenden Namen erhält diese Stadt in "Mätopia" (= Nicht-Stadt). "Wer Mätopia sieht, muß sie hassen", heißt es im Brief aus Atlantis (1966). Gegen diese "schattenfalle, umsargt vom fensterhorizont" steht "Mythopia", die mythisch gegründete und neu zu gründende Stadt, das "unerschöpfliche eiland", "einzige wohnstatt zwischen den atemzügen". Von Anfang an speist sich Poethens Material aus diesen beiden disperaten Quellen: Mätopia und Mythopia. Poethen: "Über beiden Bereichen ein Himmel, dessen Sternbilder in der Vorstellung zwei Welten aufrufen: die der Erinnerung an das Magische, an die Bilder der Mythologie, die der Gegenwärtigkeit des Technischen, der Kräfteverhältnisse zwischen schwebenden Körpern."
Das lyrische Ich sucht durch die vordergründige Wirklichkeit hindurch eine andere Dimension, eine poetisch-mythische Wortlandschaft. Als Student in Tübingen war Poethen nicht nur Hölderlin und Friedrich Beißner, sondern auch Walter F. Otto und den griechischen Mythen begegnet. Früh begriff er die mythische Phantasie als "notwendiges Organ für die poetische Erfassung von Wirklichkeit" (Paul Konrad Kurz), für die Erschaffung einer Gegenwelt mit sprachlichen Mitteln. Nebenbeibemerkt befindet sich Poethen damit in einer philosophischen Tradition, die von Paul Cassierer über Leszek Kolakowski bis hin zu Hans Blumenberg (Die Arbeit am Mythos) reicht. Allerdings besteht die Möglichkeit einer Zusammenführung jener das heutigen Bewußtsein bestimmenden Antagonismen zwischen innen und außen für Poethen nur in einer weltlichen oder, in Robert Musils Worten "taghellen Mystik", die nicht den Intellekt betäubt, sondern den Geist freimacht. Freimacht, um sich in Dinge zu verwandeln - in Steine, Bäume, wie in Poethens Baumgedicht oder in die noch "gläubige Landschaft":
Gläubige landschaft
als ende nun die regentschaft des obersten zweifels
kindlich darin zu wohnen
andenken
gelöscht am weißen kai
als ende nun die regentschaft des obersten zweifels
und alles ist voll von mündern
Der nur allzu vertraute Zweifel hindert den Geist nicht, sondern befähigt ihn viel mehr, Gesichte zu haben und Stimmen zu hören. Doch hat diese "gläubige Landschaft" mit der klassischen Antike nicht viel zu tun. Eher handelt es sich dabei, wie Marie Luise Kaschnitz in einem Nachwort zu Wohnstatt zwischen den Atemzügen bemerkte, um "ein Urreich, in dem die Dinge ihrer reinen Formen und Farben, die Erscheinungen der Natur ihren hellen mystischen Zauber noch nicht verloren haben". Zu einem ähnlichen Resultat kommt Paul Konrad Kurz (Die Neuentdeckung des Poetischen, Frankfurt 1975) wenn er Poethens Landnahme als "eine Art Ausgrabungsprozeß des Irdischen, Elementaren" deutet. In Tanz um den weißen Gott (1965) findet sich die Passage: "Ausgegraben unter der weißen zeit/... die irdenen rufe aus der ohrmuschel/die meergerüche aus den poren/die feuerzeichen aus der pupille/der windtanz aus der atmung/helle länderkaskaden weither/allfarbene luftströme im einfall/aufgehobene wildnis im frühen tanzschritt." Kurz folgert daraus: "Der lyrische Sprecher fordert die Wiederherstellung der Archä, des Ursprungs, Anfangs, des unverstellten Lebens, soziologisch gesprochen die Aufhebung der 'Entfremdung'; theologisch gesprochen die Herstellung eines solchen Verhältnisses des Menschen zu seiner Umwelt und Zeit, daß mythisches Heil erfahrbar wird." Poethens Gesellschaftskritik, so Kurz, richte sich nicht gegen dieses oder jenes gesellschaftliche System. Sie sei eine Grundkritik gegen jede Gesellschaft, die den Gott und den Menschen mit Begriffen einschnüre und dem Menschen das spontane und meditative Verhältnis zur Natur unmöglich mache.
Daß es dieser poetischen Wirklichkeitssuche nicht um Theologie geht (auch nicht um eine verkappte), darauf hat Poethen selbst mehrfach hingewiesen. In seinem Essay Der innere Mani - Griechenland nach sieben Jahren (1977) beschwört er regelrecht den sinnlich-realen Charakter jener "Epiphanien", die für ihn von der mythischen Landschaft ausgehen: "Es geistet. Darauf lassen sich keine Hochhäuser errichten. Damit läßt sich nichts beweisen. Der dritte Ort (...) wie ich ihn meine, brütet keine Theologie aus. Das Wunder, des Glaubens liebstes Kind, fehlt am Platze. Dieser dritte Ort ist kein Ort des Glaubens. Dieser dritte Ort ist unbewohnbar, und doch kein Abstraktum, denn er ist ganz aufs Hiesige bezogen. Er spendet nicht Trost und nicht Erlösung, er hebt Trost und Erlösung in sich auf (...) Er ist eine Pause (...) Schwer davon zu reden im Zeitstrom. Es ist kein Sentiment, kein pseudo-mystischer Schauder - mit der 'unio mystica', wer weiß, nur sehr fern verwandt; es ist eine einfache Erscheinung, es kann die Blume sein, der Baum, der Berggipfel; es kann eine Statue sein, ein Farbfleck, das Licht; nicht viel Aufwand ist nötig, nicht der Aufwand des Unendlichen, es ist ein Moment, in dem ein Stück Wirklichkeit wirklicher erscheint, indem es an eigener Realität zunimmt; es ist eine Sekunde (...)". Für Poethen ist Hellas voll solcher Sekunden.
IV.
Der Dichter als Seher und Mythograph. Aber als Mythograph ist er nicht blind gegenüber aktuellen Vorgängen. Nur sieht er sie anders, durchleuchtet und verwandelt ihre Gestalt. Als 1967 die griechischen Obristen die Macht an sich rissen, setzte sich Poethen, zu innerst getroffen, mit der anrollenden Militärmaschinerie auseinander. Der Zyklus Im Namen der Trauer (1967) versteht die Machtergreifung der Militärs als Modellfall der Unterdrückung von Geist und Leben, wird zum Menetekel des Weltfaschismus:
Damals hatten die toten noch einmal gesprochen von dem was sie wußten
manche der hiesigen nickten mit ihren köpfen
manche lachten aus ihren bäuchen
manche fühlten es nicht im brustbein
und so hob es sich auf
daß also die stadt unters netz kam
daß die panzer herdrehten und vertraulich ausverleibten
sie kratzten noch die besorgnis aus ihren ketten
dann floß das wasser auf ihr geheiß und auf ihr geheiß endete jeder satz
da verließen die toten ihre stadt
und gingen von allem fort in die eigene haut.
Der Zyklus rekurriert auf den Mythos von dem Gott, der durch die Moiren sein geliebtes Kind verliert und von der Geburt der Kunst aus dem Geist der Trauer. Von nun an ist es die "Göttin Trauer", noch größer als der Gott, die das Lied und den Tanz eingibt. Im Namen der Trauer markiert zugleich einen Wendepunkt in Poethens poetischer Entwicklung. So hermetisch geschlossen die Oberfläche seiner Texte auch scheinen mochte, spätestens jetzt wird eine existenzielle Er-schütterung, zum Teil mit traumatischen Zügen, spürbar: "ich sehe die hirndurchsuchung/die schrecksekunden rund um die uhr/das standrecht von küste zu küste." Was Poethen in der Folgezeit geschrieben hat - etwa den Zyklus Aus der unendlichen Kälte (1970), steht im Zeichen der erzwungenen Entfremdung von der griechischen Wahlheimat. Der Dichter sucht sich einen Standort weit außerhalb, im Weltall; eine Perspektive, aus der die Erde "nicht mehr wahrnehmbar" ist. Durchbrochen werden soll mit diesem Perspektivwechsel die gewöhnliche Als-ob-Haltung, in der wir so tun, "als gäbs den orion". Das poetologische Bekenntnis auf dieser Stufe lautet:
Daß ich noch immer dieses leben will
innerhalb seiner durchlässigen haut
an den grenzen zum wahn
der vom stöhnen der heißen Gaia herweht
Das poetische Sprechen aus solcher Perspektive bedeutet: "den durst der mitgefangenen löschen/nur mit eigenem durst."
Die griechische Diktatur bricht nach sieben Jahren zusammen. Doch der geschichtliche Einbruch in die Sprache des Dichters Poethen hält an. Immer deutlicher schält sich jetzt ein Grundproblem moderner Lyrik heraus: Der Zweifel an der Sprache selbst, an den poetischen Fiktionen. Paul Celan hatte von einer nur noch "nachzustotternden Welt" gesprochen. Poethens Dichtung teilt zunehmend
jenen Sprachvorbehalt und wird - im Vergleich zu früheren, an antiken Metaphern überreichen Zyklen - zunehmend lakonischer. Wenn klassifikatorische Einteilungen nicht immer auch den Ruch des Künstlichen, eine lineare Entwicklung Hypostasierenden hätten, könnte man vielleicht von einer dritten Phase in der Lyrik Poethens sprechen, in der sich der Autor zunehmend von klassisch-antikem Sprachfundus freimacht, sich dem Alltäglichen zuwendet. In dem Gedicht "Zur Halde" aus dem Band Auch diese Wörter (1985) sieht die 'Landnahme' des Dichters so aus:
Wenn ich nicht mehr weiß
wo mir der kopf steht
muß ich zur halde gehen
ich stiere da herum
blech stoff und plastik
scherben stein und bein
zett und alpha
auge und zahn
ich rieche da herum
die offenen gräber
(...)
Im Vordergrund dieses Bandes stehen jedoch die geschichtlichen Einbrüche in die Sprache. Das Problem, das sich für den Lyriker daraus ergibt: Soll seine Sprache nicht blind vor der Realität werden, muß er die Unsagbarkeit des Schreckens, die Ohnmacht der Sprache und das tausendfache Schweigen der Opfer, also jener, die nicht mehr sprechen können, in jeder Zeile mitreflektieren. Sprache ist nicht länger Eigentum und Heimat des Dichters (wie Weiland für Hölderlin), umgekehrt ist keine neue Heimat, keine neue Sprache in Sicht. Eine im Grunde aporetische Situation. Das poetologische Bekenntnis des Dichters Poethen, der "regional empfindet, aber planetarisch denkt" (Hans-Jürgen Heise: "Regional empfunden, planetarisch gedacht", in: Süddeutsche Zeitung v. 14./15.Dez. 1985) auf dieser Stufe lautet: "
Wo denn meine heimat sei
auschwitz sag ich
hiroschima
aber das lügt aus mir
der rhein liegt dazwischen
dazwischen liegt die ägäis
und daß ich noch immer trinken will
und daß ich diese hütten baue
hier an den hang
dort ans meer
und zeile um zeile
in solchem wahn.